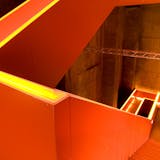Nachhaltige Entwicklung
Wie Wandel gelingen kann
Der Kompass steht auf Zukunft
Das Prinzip einer nachhaltigen Entwicklung ist bereits in den Grundsätzen Zollvereins verankert: Mit dem Auftrag zur denkmalgerechten Erhaltung und Wiedernutzbarmachung des ehemaligen Industriekomplexes ist es eine der Kernaufgaben der Stiftung Zollverein, die mehr als 90 Gebäude auf dem Gelände der Zeche und Kokerei einer neuen Nutzung zuzuführen. Wo früher Gas zwischengespeichert wurde, sprießt heute Bio-Gemüse bei dem gemeinnützigen Bildungsprojekt „Ackerhelden machen Schule“. Wo einst die Funken in der Zentralwerkstatt flogen, diskutieren heute internationale Forscher und Forscherinnen über Industriekultur und gesellschaftliche Verantwortung. Und wo noch vor wenigen Jahren Rauch aus den Schornsteinen der Kokerei quoll, nisten heute gefährdete Vogelarten.

Darüber hinaus orientiert sich die Stiftung Zollverein bei der nachhaltigen Entwicklung des Standorts an ihrem umfänglichen Konzept sowie dem eigenen Leitbild in Anlehnung an die von den Vereinten Nationen formulierten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals). Das Nachhaltigkeitskonzept umfasst fünf zentrale Handlungsfelder: Klimaschutz, Transformation, Zollverein Park, Zukunftsstandort sowie Welterbe für alle.

Klimaschutz
Dass Zollverein stark auf eine nachhaltige Entwicklung des Geländes abzielt, ist keine Selbstverständlichkeit. Kohleabbau und Koksproduktion waren zu Betriebszeiten der Zeche und der Kokerei Zollverein verantwortlich für große Mengen an Treibhausgasen, belasteten die Umwelt und die Gesundheit der Menschen – sowohl auf dem Industriekomplex als auch in der Nachbarschaft. Heute verfolgt die Stiftung Zollverein das Ziel, das Areal eigenständig mit Erneuerbaren Energien zu versorgen, Ressourcen sinnvoll zu nutzen und die Emissionen gering zu halten. Was bedeutet das konkret? Ein Beispiel: Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen, beauftragte die Stiftung Zollverein die Fraunhofer-Gesellschaft mit dem Erstellen einer Machbarkeitsstudie. Das Potenzial zur klimaneutralen Wärme- und Energieversorgung sollte erschlossen und in konkrete Handlungsschritte überführt werden – die außergewöhnlichen Voraussetzungen des Welterbes dabei immer im Blick.

Transformation
Nachhaltige Entwicklung gelingt nur im Miteinander. Daher versteht sich das UNESCO-Welterbe Zollverein als Plattform für Austausch, Ideen und Entscheidungsfindung. So entsteht ein Netzwerk aus Städten, Unternehmen, Universitäten, NGOs und kulturellen Institutionen, das geschlossen das Ziel verfolgt, die Transformation des Areals rund um Zeche und Kokerei weiter voranzutreiben. Zudem bilden sich Partnerschaften auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene mit Fachleuten, Bürgerinnen und Bürgern sowie Stakeholdern. In diesem Sinne befassen sich beispielsweise Architektur-Studierende verschiedener Universitäten regelmäßig damit, wie denkmalgeschützte Bauten umgenutzt werden können – ganz nach dem Prinzip „Erhalt durch Umnutzung“.

Zollverein Park
70 von insgesamt 100 Hektar des Geländes entfallen auf den Zollverein Park. Nach Stilllegung von Zeche und Kokerei kehrte die Tier- und Pflanzenwelt zurück – und mit ihr eine beeindruckende Artenvielfalt. Zollverein ist ein extremer Standort mit nährstoffarmer Erde und mit Kohleschlammböden, die sich im Sommer auf 60 Grad aufheizen können. Doch die Natur passte sich an, Schritt für Schritt. Heute nennen über 540 Blühpflanzen- und Farnarten Zollverein ihr Zuhause, genauso wie 60 Vogel- und über 40 Wildbienenarten. Die Liste der Biodiversität auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein ließe sich weitaus länger fortsetzen. Zu Gast sind saisonal zudem Schafe und Ziegen. Mit ihnen setzt die Stiftung Zollverein bei der Grünflächenpflege auf tierische Unterstützung: Während die Schafe das Gras „mähen“, fressen die Ziegen unter anderem invasive Arten wie den Japanischen Staudenknöterich mit dem Resultat, dass auch heimische Arten wieder Luft und Licht bekommen.

Zukunftsstandort
Ein Bildungscampus, zwei Museen, zahlreiche Event- und Tagungs-Locations und rund 50 Unternehmen tragen dazu bei, dass das Welterbe einen Zukunftsstandort für Tourismus, Kultur sowie Kreativ- und Digitalwirtschaft darstellt. Für innovative Unternehmen und Startups öffnet das UNESCO-Welterbe Zollverein gern seine Türen und steht ihnen als Reallabor zur Verfügung. So erprobte die Stiftung bereits in Kooperation mit der „Bahnen der Stadt Monheim GmbH“ autonom fahrende Busse und mit der „AuRaSys UG“ sowie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg automatisierte Lastenräder. In Hinblick auf die Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027 planen die Stiftung Zollverein und das Startup Greens – ansässig im Gründungs- und Unternehmenszentrum Triple Z – eine Partnerschaft. Greens betreibt eine hochautomatisierte Vertical-Farming-Anlage, in der ganzjährig Erdbeeren von höchster Qualität produziert werden – und das nachhaltig, pestizidfrei und mit minimalem Ressourcenverbrauch.

Welterbe für alle
Hinter dem Handlungsfeld „Welterbe für alle“ steht die zentrale Botschaft: Hier können alle teilhaben, unabhängig von Herkunft, Geschlecht Alter, Behinderung und Religion. Es geht um Bildung, Quartiersarbeit, Kultur und Inklusion. Welterbestätten repräsentieren die gesamte Menschheit – daher verfolgt die Stiftung den Anspruch, dass Zollverein im Umkehrschluss allen Menschen zugänglich ist. Die Zeiten der „verbotenen Stadt“, in denen der Zutritt zum Gelände den Werkszugehörigen vorbehalten war, sind vorbei. Vom grünen Klassenzimmer der „Ackerhelden machen Schule“ auf der Kokerei über partizipative Angebote, die sich auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den angrenzenden Stadtteilen konzentrieren bis hin zur barrierefreien Gestaltung von Veranstaltungshighlights wie der Zollverein-Eisbahn: Das Welterbe ist ein Ort, an dem alle Menschen willkommen sind und eingeladen, auf Entdeckungstour zu gehen und Zollverein mitzugestalten.
Ansprechpartnerin
-
Anna Ehlert
Nachhaltigkeits- und Umweltmanagement -
Telefon 0201 24681-127
-
E-Mail anna.ehlert
@zollverein.de