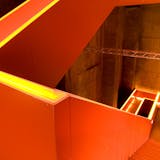Essen. Erstmals in der 70-jährigen Geschichte der Internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem werden Exponate aus der Objektsammlung in Deutschland gezeigt. In der Halle 8 auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein präsentieren die Stiftung Zollverein zusammen mit dem Freundkreis Yad Vashem e.V. und der Internationalen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem sowie dem Ruhr Museum ab Montag, 6. März 2023, „Sechzehn Objekte. Eine Ausstellung zu siebzig Jahren Yad Vashem.“ Die Gegenstände kehren für begrenzte Zeit nach Deutschland zurück. Die Ausstellung erinnert daran, dass jeder Ort in Deutschland durch den Holocaust einen Teil seiner Geschichte, seiner Identität verloren hat. Die Gegenstände stehen für unzählige jüdische Leben und Gemeinschaften, die durch den Nationalsozialismus zerstört wurden.
Die Gegenstände stammen aus unterschiedlichen Städten, jedes steht für eines der heutigen 16 Bundesländer. Darunter das berühmte Foto des Chanukka-Leuchter der Kieler Familie Posner, ein selbst angefertigter Thoraschrein des Hamburger Schuhmachers Leon Cohen, den er ins Ghetto Theresienstadt mitnahm, oder ein Stethoskop des Berliner Arztes Hermann Zondek, das er auf seiner Flucht nach Jerusalem 1933 bei sich hatte. Die Objekte erzählen unterschiedliche und einzigartige Geschichten. So auch das nordrheinwestfälische Objekt, eine Abendtasche aus Essen. Sie gehörte Jenny Bachrach. Die Essenerin lebte mit ihrem Mann Hermann und (Adoptiv-) Tochter Eva in der Moorenstraße in Essen-Rüttenscheid. Die Bachrachs konnten Eva noch außer Landes bringen, doch sie selbst überlebten die Verfolgung durch die Nationalsozialisten nicht. Nach der Enteignung wurden sie im April 1942 deportiert und ermordet. Die Abendtasche ist eines der wenigen Erinnerungsstücke, die Eva Bachrach vom Besitz ihrer Eltern blieb.
Präsentiert werden die Objekte vor einer zeitgenössischen Fotografie ihres ursprünglichen Herkunftsortes. Begleitend zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit Informationen zu allen Objekten und ihren einstigen Besitzerinnen und Besitzern.
Zur Ausstellung bieten die Alte Synagoge Essen, das Ruhr Museum, die Stiftung Zollverein und der Freundeskreis Yad Vashem e.V. ein umfangreiches Rahmenprogramm an (s. gesondertes Dokument). In einer Vortragsreihe wird das Thema Erinnerungskultur im Wandel der Zeit in den Mittelpunkt gerückt. Dabei geht es um historische Aspekte und um konkrete Wege zukünftiger Erinnerung sowie des Gedenkens. Diese Frage stellt sich, wenn die letzten Zeitzeugen der Shoah nicht mehr leben, dann werden Erinnerungsstücke und Dokumente zu Zeitzeugen. Im Rahmen von Führungen (auch durch die Kuratorinnen) erfahren Gäste spannende Hintergründe zu den Gegenständen und ihrer Inszenierung in der Ausstellung. Bei Spaziergängen erwandern die Teilnehmenden die Spuren jüdischen Lebens in Essen und besuchen Orte, an denen die Besitzerin des Essener Objektes gelebt hat. So etwa das „Roba-Haus“ (heute „Osram-Haus“) in der Kruppstraße, wo Hermann Bachrach als Geschäftsmitinhaber und Möbelfabrikant nach 1929 gearbeitet hatte.
Die Ausstellung wird bis zum Samstag, 29. Mai, auf Zollverein zu sehen sein. Sie ist täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Kuratiert wurde sie von der Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem, Ruth Ur, zusammen mit Michael Tal, Leiter der Objektsammlung, Yad Vashem. Anfang des Jahres wurde die Ausstellung im Bundestag gezeigt.
Die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 5. März, kann auf dem Youtube-Kanal der Stiftung Zollverein ab 16:00 Uhr live mitverfolgt werden:
https://www.youtube.com/watch?v=0hUY-BeXHgE
Pressebilder können unter den untenstehenden Links heruntergeladen werden.
Veranstaltung: Sechzehn Objekte. Eine Ausstellung zu siebzig Jahren Yad Vashem
Zeit: 6. März 2023 – 29. Mai 2023, täglich (auch montags!) von 10:00 – 18:00 Uhr
Veranstalter: Stiftung Zollverein in Kooperation mit dem Freundeskreis Yad Vashem e.V. und dem Ruhr Museum
Ort: Halle 8, UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen
Eintritt: frei; um eine Spende für den Freundeskreis Yad Vashem e.V. wird gebeten
ZITATE
„Kein Objekt in unserer Ausstellung spricht deutlicher von einer verlorenen und fast vollständig zerstörten Kultur als die wunderschöne Abendtasche aus Essen. Ich kann es kaum glauben, dass sie nach all diesen Jahren wieder hier ist.“
Ruth Ur, Kuratorin der Ausstellung und Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem in Berlin e.V.
„This exhibition is the first time Yad Vashem has curated an entire exhibition where all the items share a common nationality; each item on display represent a unique individual story of people from Germany. We hope that the objects and their local histories will spark interest and a new way of engaging with the past.“
Michael Tal, Co-Kurator der Ausstellung und Leiter der Objektsammlung in Yad Vashem
„Mit der Ausstellung „Sechzehn Objekte“ erinnern wir uns der Vielfalt jüdischen Lebens vor 1939. Das Rahmenprogramm zeigt uns dabei neue Wege des Erinnerns auf, in einer Zeit da die letzten Zeitzeugen der Shoah hochbetagt sind.“
Dr. Uri-Robert Kaufmann, Leiter der Alten Synagoge Essen
„Die Stiftung Zollverein sieht sich in der Verantwortung durch Projekte die Erinnerungskultur an die Verbrechen des Nationalsozialismus aufrecht zu erhalten und mitzugestalten.“
Prof. Heinrich Theodor Grütter, Mitglied des Vorstandes der Stiftung Zollverein und Direktor des Ruhr Museums
Über den Freundeskreis Yad Vashem e.V.
Eine der zentralen Aufgaben des 1997 gegründeten deutschen Freundeskreises von Yad Vashem ist, die Arbeit der internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Dafür stärkt der Verein nicht nur die Beziehungen zwischen der Holocaust Gedenkstätte und deutschen Institutionen, sondern bietet zahlreiche Bildungs- und Gedenkprogramme in Zusammenarbeit mit Yad Vashem an.
www.yad-vashem.de
Über Yad Vashem
Die Internationale Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem wurde im Jahre 1953 vom israelischen Parlament gegründet. Sie befindet sich auf dem Berg der Erinnerung in Jerusalem und widmet sich der Dokumentation des Holocaust, der Forschung, der Bildung und dem Gedenken an die sechs Millionen jüdischen Männer, Frauen und Kinder, die während des Holocausts ermordet wurden, sowie an die zerstörten jüdischen Gemeinden.
www.yadvashem.org
Über die Alte Synagoge Essen
Die Alte Synagoge, Kulturinstitut der Stadt Essen, befindet sich im früheren Synagogenbau der jüdischen Gemeinde in Essen. Das Baukunstwerk gehört zu den größten und architektonisch bedeutendsten, freistehenden Synagogenbauten Europas aus der Anfangszeit des 20. Jahrhunderts. Seit 2010 wird in der Alten Synagoge eine interaktive Dauerausstellung über zeitgenössisches Judentum gezeigt. Im Hauptraum am Edmund-Körner-Platz in der Essener Innenstadt findet die Vortragsreihe zur Ausstellung statt. Zudem können Gäste mehr über die Geschichte der Familie Bachrach erfahren.
Über die Stiftung Zollverein
Die Stiftung Zollverein hat den Auftrag, das UNESCO-Welterbes Zollverein in Essen zu bewahren und zu entwickeln und ist Eigentümerin der übertägigen Gebäude und Anlagen. Die „schönste Zeche der Welt“ gehört seit 2001 zum UNESCO-Welterbe. Seitdem werden Zeche und Kokerei Zollverein als identitätsstiftendes Denkmal bewahrt und mit musealen Angeboten, Konzerten und Veranstaltungen kulturell bespielt. Mit
über 1,5 Mio. Besuchern jährlich ist Zollverein die größte Touristenattraktion im Ruhrgebiet und mit zahlreichen Unternehmen aus der Kreativ- und Innovationswirtschaft ein wachsender Wirtschaftsstandort.
www.zollverein.de
Über das Ruhr Museum
Das Ruhr Museum in der ehemaligen Kohlenwäsche auf dem Zollverein ist das Regionalmuseum des Ruhrgebiets. In seiner Dauerausstellung erzählt es mit 6.000 Exponaten die faszinierende Natur- und Kulturgeschichte des Reviers, einschließlich der Zeit des Nationalsozialismus und der Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im Ruhrgebiet. Das Team des Museums hat den Aufbau der Ausstellung begleitet und die wertvollen Exponate eingelegt.
www.ruhrmuseum.de